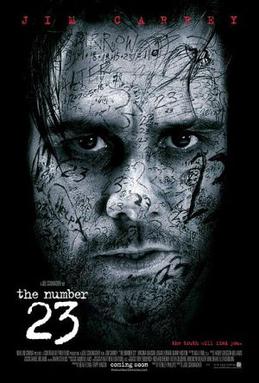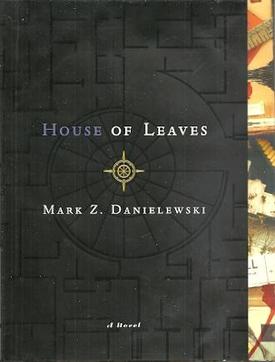Eine Mordsgaudi. Allerdings. Die Lektürefreude war enorm und mit ein wenig Trauer im schlaflosen Auge wurden die letzten Seiten sehr schnell erreicht. Das muss am Anfang dieser Notiz betont werden, denn die folgende rudimentäre Umschreibung dieses Artikels wird vielleicht ein wenig abschreckend anstrengend klingen, nach kopflastigem Deppendrama mit zuviel Schall und zu wenig Wahn.
Also. Inhaltlich kann man beim House of Leaves vier Ebenen ausmachen. Da sind einmal die Videos von einem Mr. Navidson, der mit seiner Familie in ein Gruselhaus einzog und dort unter anderem einen Bruder und vielleicht auch seinen Verstand verlor. Dann gibt es zum Zweiten einen blinden alten Mann, der eine gewaltige Arbeit über jene Videos schrieb/kompilierte (eine Verneigung vor dem Gesamtwerk von Señor Borges). Und zum Dritten gibt es Johnny Truant, eine Tattoo-Shop-Aushilfe, die jenes Manuskript findet und sich an dessen Überarbeitung macht. Als letztes gibt es da noch die ominösen Verleger, die Fußnoten und Fußnoten unter Fußnoten setzen und die untergeordneten Texte wiederum eingrenzen.
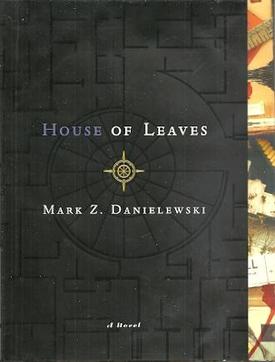
Und alle brabbeln durcheinander. Alle erzählen diverse Seiten- und Untergeschichtchen. Besonders verstörend ist der stetige Bezug auf Zitate (von Professoren bis Letterman), die hinaus in die Öffentlichkeit führen. Alle reden von Navidsons Haus. Warum nicht der Leser?
So weit, so wenig Spaß versprechend weil kompliziert. Sprachspiele, baby! Differänz mit 'ä'! Trotzdem ein stabiles U.
Danielewski präsentiert sein Werk in optionalen Stückchen. Wo Pynchon Durchhaltevermögen fordert, da lädt der Autor hier zum Überspringen und zur Selektion ein. Die Kohärenz bleibt dank der gewaltigen Übermetapher des Hauses, des Raumes, des (Gedanken-) Gebäudes. Dies wird von den Navidsons wie auch von allen anderen, inklusive dem Leser, erforscht. Es gibt immer wieder Spannungsmomente, die das Interesse wecken und an denen man sich durch die Kapitel hangelt. Ausverkauf? Sei's drum.
Der Roman zielt zwischen die Definitionen von Hoax und Hype und Halluzination und spielt somit mit durchaus akademisch relevanten Themen. Besondere Aufmerksamkeit erhält der wie gesagt echte/gedachte Raum. Die Brisanz vom spatial turn verdeutlicht sich. Sie wird ja auch von
Sloterdijks Raumfahrt bescheinigt (deren zweiter Band derweil in stetiger Verzehrung im Graben ist). Sowohl Mark als auch Peter zitieren Gaston Bachelard, dessen Poetics of Space wohl ihren Weg in die ToDo-Liste finden muss.
Im Navidson Haus kollabiert Raum ins Nichts: man findet eine furchtbare Wendeltreppe, die hinunter in die All-Abwesenheit führt. Downward Spiral, ho! Somit wird sogar Trent Reznor zitiert.
Man mag nun auch spottend sagen, dass Danielewski eigentlich "Deconstruction for Dummies" schreiben wollen. Aber das träfe sowohl die Sache selbst als auch den vorliegenden Roman. Wie unheimlich! Wer hat denn hier das Sagen? Letztlich der Leser, aber er weiß es nicht. Der Leser ist die fünfte Ebene, mindestens.
Und witzig ist Danielewski auch noch. Es werden an einer Stelle Interviews mit bekannten Menschen geführt, darunter Stephen King und Jacques Derrida (!). Der Autor suhlt sich mit solchen Einfällen in Offensichtlichkeit und trägt somit zum Charme des Romans durchaus bei. Er unterstreicht die Nähe vom Ausverkauf der gothic fiction und intellektuell gelebter Verunsicherung. Somit beleuchtet er das Grunddilemma der Relevanz bei der Arbeit mit Literatur und Texten im Allgemeinen und Speziellen.
Insgesamt stellt House of Leaves (das Haus der Blätter und der Abschiede) eine Huldigung an den Prozess und das Ergebnis des Lesens dar. Ein ziemlich cooles Vehikel, bei dem der eine oder der andere wahrscheinlich erfrieren wird wie im extradimensionalen Kellergewölbe des Hauses. Genau diese Hermetik kitzelt und verunsichert zugleich.
Beim
Wiki-Eintrag kann man einige Beispiele des ambitionierten Layouts und weitere Verweise finden.
He, und Bret Easton Ellis findet's auch gut. Auf geht's in den örtlich fixierten Lunar Park.
 Das Booklet bringt es auf den Punkt: der Wilde Westen durfte nicht sterben. Zur Zeit der wilden, aggressiven 1970er wurden die Marvel Comics eine Spur härter und ließen Gwen Stacy ab- und den Black Panther hochleben. Der Bestrafer aus den Comics ist wie Batman vom Konkurrenten DC nicht mit Superkräften, aber eben mit tüchtig Wut auf alles ausgestattet.
Das Booklet bringt es auf den Punkt: der Wilde Westen durfte nicht sterben. Zur Zeit der wilden, aggressiven 1970er wurden die Marvel Comics eine Spur härter und ließen Gwen Stacy ab- und den Black Panther hochleben. Der Bestrafer aus den Comics ist wie Batman vom Konkurrenten DC nicht mit Superkräften, aber eben mit tüchtig Wut auf alles ausgestattet.