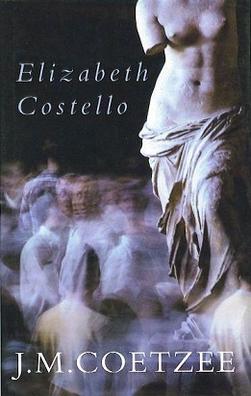Wie kann das sein? Wie macht er das?
Wie kann das sein? Wie macht er das?Das große Bild ist der Fluss. Ja klar, gähn-gähn. Aber nein.
Manche leben unter Brücken, manche werden hier ihren Müll los. Andere brechen winters ins Eis und verschwinden. Dann sind da noch Fischer wie Suttree: sein Hausboot steht im stehenden Gewässer.
Suttree ist ungebunden und somit haltlos. Da waren nie Stricke die hätten reißen können. Unter den Menschen ist der Sumpf. Wo hört das schwarze Wasser auf und wo fängt die Erde an? Manchmal tritt der Fluss über die Ufer und frisst eine Straße oder unterhöhlt den Friedhof und versenkt Grabsteine. Die Menschen sind blinde, einfarbige Insekten, die zwischen Provisorien und Fäkalien arbeiten, saufen und strampeln.
Im Knast lernt Suttree Gene kennen, einen Menschen der bald zum Child of God werden kann. Das Attribut "einfach" hat schon zuviele Silben, um ihn zu beschreiben. Wie er versucht, ein waidwundes Schwein mit einem Zinneimer und einem Holzscheit zu erschlagen, ist atemberaubend. Oder die Sache mit den 42 Fledermäusen.
Vielfarbige Galle ist und bleibt ein Thema.
Faulkner war nie so sichtbar wie hier. Diese Sprache: grob und körnig und treffend und schwarze Löcher reißend. Das Unwort "Erhaben" geistert herum, aber nein: das würde ja heißen, das Verstand und Vernunft irgendwie beteiligt wären. McCarthy schreibt nicht für Menschen. Harold Bloom nennt ihn den wichtigsten alten weißen Literaten der USA neben Roth, Pynchon und Delillo. Recht so. Bei Suttree ist der Leser eines der Insekten, das nur kurz in jenem Kosmos zu Besuch ist, ohne ihn ganz zu verstehen.
Und das verstörendste daran ist der humoristische Einschlag. Jawohl, Suttree ist irgendwie komisch. Wie kann das sein?
Dieser Eintrag mag verfrüht sein, denn er entsteht auf halber Strecke. Suttree ist eines der wenigen Bücher, bei denen das Umblättern weh tut weil man damit dem Ende näher kommt.
Jagut, das mag nur eine effiziente Selbsthypnose sein. Keiner ist wie Cormac und der Enthusiasmus lässt sich nur schwer zügeln.
Kaufen, fressen, lachen, weinen.